 Der ex UBS-Manager Raoul Weil steht in Fort Lauderdale (Florida) vor Gericht. Anklage: Beihilfe zum Steuerbetrug im grossen Stil. Es drohen ihm fünf Jahre Gefängnis. Zum Prozessauftakt sind heute diverse Schweizer Medien angereist, und – ach ja, zugegeben, ich bin einer von ihnen. Neben dem Geschehen im Gericht interessiert vor allem eines: Schnappschüsse des Angeklagten. Weil im Gerichtssaal und auf dem Areal Kameras verboten sind, warten Fotografen, Kameraleute und Journalisten (mit Handy bewaffnet) mehr oder weniger geduldig auf dem Trottoir an der Strassenecke.
Der ex UBS-Manager Raoul Weil steht in Fort Lauderdale (Florida) vor Gericht. Anklage: Beihilfe zum Steuerbetrug im grossen Stil. Es drohen ihm fünf Jahre Gefängnis. Zum Prozessauftakt sind heute diverse Schweizer Medien angereist, und – ach ja, zugegeben, ich bin einer von ihnen. Neben dem Geschehen im Gericht interessiert vor allem eines: Schnappschüsse des Angeklagten. Weil im Gerichtssaal und auf dem Areal Kameras verboten sind, warten Fotografen, Kameraleute und Journalisten (mit Handy bewaffnet) mehr oder weniger geduldig auf dem Trottoir an der Strassenecke.
 In der Mittagspause ist es endlich soweit. Wie die Hyänen lungern die Medienleute herum, schalten jetzt die Geräte ein, zielen und – drücken ab. Raoul Weil und seine Frau Susanne ertragen den Spiessrutenlauf mit Fassung. Sie halten Händchen und versuchen permanent zu lächeln. Sie wollen – begleitet von Anwälten – über die Strasse, vergessen aber, den Knopf an der Ampel zu drücken. So bleibt es ewig rot, und die Kameras kommen rege zum Einsatz. Endlich grün! Aber die Meute verfolgt die Beute über die Strasse und noch weiter. Dann lässt sie sie plötzlich ziehen, irgendwie scheint eine Beisshemmung zu greifen, je weiter sich das Paar vom Gerichtsgebäude entfernt. Ein erbärmliches Schauspiel eigentlich. Und ich frage mich: Braucht das die Schweizer Öffentlichkeit wirklich? Oder ist es blosse Selbstbefriedigung der Journalisten?
In der Mittagspause ist es endlich soweit. Wie die Hyänen lungern die Medienleute herum, schalten jetzt die Geräte ein, zielen und – drücken ab. Raoul Weil und seine Frau Susanne ertragen den Spiessrutenlauf mit Fassung. Sie halten Händchen und versuchen permanent zu lächeln. Sie wollen – begleitet von Anwälten – über die Strasse, vergessen aber, den Knopf an der Ampel zu drücken. So bleibt es ewig rot, und die Kameras kommen rege zum Einsatz. Endlich grün! Aber die Meute verfolgt die Beute über die Strasse und noch weiter. Dann lässt sie sie plötzlich ziehen, irgendwie scheint eine Beisshemmung zu greifen, je weiter sich das Paar vom Gerichtsgebäude entfernt. Ein erbärmliches Schauspiel eigentlich. Und ich frage mich: Braucht das die Schweizer Öffentlichkeit wirklich? Oder ist es blosse Selbstbefriedigung der Journalisten?


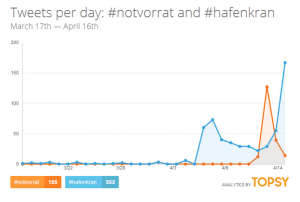

 Er steht seit über 30 Jahren auf der Bühne, parodierend, persiflierend und posierend:
Er steht seit über 30 Jahren auf der Bühne, parodierend, persiflierend und posierend:  Ist Giacobbo heute besser als damals, oder hat er nachgelassen? Mit Sicherheit ist er braver geworden – gezwungenermassen. Ein katholischer Würdenträger namens „Karel Gott Wojtyla“, der seltsame sexuelle Neigungen öffentlich auslebt und dafür im Beichtstuhl die Gurtenpflicht einführt, würde am Schweizer Fernsehen wohl kaum toleriert. Aber Giacobbos Schalk blitzt auch heute immer wieder auf. Man kann ihn in seinen Augen erkennen, oder in seinem bisweilen fast diablischen Grinsen. Als ich ihn neulich im Kaufleuten bei der Aufzeichnung von
Ist Giacobbo heute besser als damals, oder hat er nachgelassen? Mit Sicherheit ist er braver geworden – gezwungenermassen. Ein katholischer Würdenträger namens „Karel Gott Wojtyla“, der seltsame sexuelle Neigungen öffentlich auslebt und dafür im Beichtstuhl die Gurtenpflicht einführt, würde am Schweizer Fernsehen wohl kaum toleriert. Aber Giacobbos Schalk blitzt auch heute immer wieder auf. Man kann ihn in seinen Augen erkennen, oder in seinem bisweilen fast diablischen Grinsen. Als ich ihn neulich im Kaufleuten bei der Aufzeichnung von 

